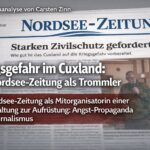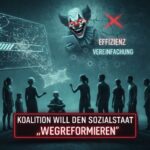Friedrich Merz inszeniert sich als europäischer Führer in Zeiten der Krise – mit dem Ukraine-Krieg als Bühne, Russland als Feindbild und der militärischen Aufrüstung als wirtschaftspolitischem Katalysator. In Teil 2 meiner Essay-Reihe zeige ich, wie Merz eine geopolitische Erzählung zur Legitimierung seiner Kanzlerschaft aufbaut – und warum diese Strategie brandgefährlich ist.
Statt Diplomatie: Drohungen. Statt Europa als Friedensmacht: Europa als Rüstungsprojekt.
Während die USA längst den Rückzug vorbereiten, setzt Berlin auf Eskalation – in der Hoffnung, aus der Krise politische Führung zu gewinnen. Merz treibt diese Linie auf die Spitze. Doch was, wenn der Preis dafür nicht nur wirtschaftlicher Zerfall, sondern ein europäischer Flächenbrand ist?
Ein Kanzler ohne Schonfrist
Friedrich Merz trat sein Amt an wie ein Mann, der nichts mehr zu verlieren hat. Im Inland angeschlagen, in der eigenen Partei umstritten, und mit rapide sinkenden Zustimmungswerten für sich selbst wie auch für die CDU – suchte er seine Bühne anderswo. Und er fand sie: in der Außenpolitik. Oder besser gesagt – in der Außeninszenierung.
Von Beginn an stellte Merz den Ukraine-Krieg ins Zentrum seiner Kanzlerschaft. Nicht als Herausforderung, sondern als Gelegenheit. Als Hebel, um sich selbst zu legitimieren. Als Projektionsfläche für eine Führungsrolle, die er im Inland nie erringen konnte.
Dabei ging es nie nur um Russland, nie nur um Solidarität. Es ging – und geht – um eine geopolitische Aufladung der eigenen Bedeutung. Um die Wiederherstellung deutscher Führungsansprüche – in Europa, in der NATO, im westlichen Bündnis. Und nicht zuletzt: um die Auslöschung der letzten Spuren Merkel’scher Zurückhaltung.
Der Krieg als Bühne für Stärke
Merz redet oft von „Klarheit“. Doch was er praktiziert, ist Eskalation. Schon als Oppositionsführer hatte er eine Vorliebe für martialische Worte und Forderungen wie den Taurus. Jetzt als Kanzler droht er Moskau mit Fristen und kündigt „rote Linien“ an, die wöchentlich verstreichen.
Er inszeniert sich als Verteidiger der Freiheit. Doch seine Rhetorik klingt zunehmend wie die eines Mannes, der im Krieg die letzte Ordnungsmöglichkeit für eine aus den Fugen geratene Welt sieht.
Diese Haltung ist nicht nur gefährlich – sie ist auch kurzsichtig. Denn sie ignoriert, dass sich die geopolitische Landschaft längst verschoben hat. Die USA, früher treibende Kraft in der Ukraine-Politik, bereiten sich auf Rückzug und neue Prioritäten vor. Die Republikaner – und vor allem Donald Trump – haben keinerlei Interesse mehr an einem Stellvertreterkrieg, der immer teurer wird und keinen klaren Ausgang hat.
Während Washington abwinkt, rüstet Berlin auf.
Europa unter deutscher Flagge?
In dieser Konstellation sieht Merz seine Chance. Die Franzosen zögern, die Briten sind raus – und das Vakuum, das die EU hinterlässt, soll Deutschland füllen. Merz will Kanzler des neuen Europas werden: nicht durch Einigung, sondern durch Voranpreschen.
Militärisch. Ökonomisch. Rhetorisch.
Die Vorstellung, dass Deutschland wieder „Führung übernehmen“ müsse, zieht sich wie ein roter Faden durch seine Reden. Was dabei übersehen wird: Europas Stärke lag nie in der Dominanz Einzelner, sondern im Ausgleich der Unterschiedlichen. Doch dieser Ausgleich stört Merz. Er sieht ihn als Schwäche. In seiner Logik muss Europa marschieren lernen – am besten im Gleichschritt.
Diese Haltung ist nicht nur geschichtsvergessen. Sie ist brandgefährlich.
Der neue europäische Militarismus
In enger strategischer Gefolgschaft mit Verteidigungskreisen und der FDP-Hardlinerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann – die öffentlichkeitswirksam den Ton vorgibt – treibt Merz die Militarisierung Europas entschlossen voran. Der Ukraine-Krieg wird dabei zur moralischen Rechtfertigung für einen sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel:
- Massive Aufrüstung nationaler Armeen
- Gemeinsame Schuldenaufnahme für Rüstungsprogramme
- Aufweichung oder Abschaffung der Schuldenbremse
- Umwidmung von Industrieförderung in Verteidigungssubventionen
All das wird unter dem Etikett einer „europäische Handlungsfähigkeit“ verkauft. Doch in Wahrheit ist es ein gigantisches Umverteilungsprogramm – weg von Sozialstaat und Daseinsvorsorge, hin zu Rüstungskonzernen, Finanzlobbys und transnationaler Technokratie.
Europa wird damit nicht handlungsfähiger – sondern unsozialer. Die Lasten tragen nicht die politischen Entscheider, sondern die Menschen in den Kommunen, auf dem Land, in den Städten – die schon jetzt unter Inflation, Wohnungsnot und einem ausblutenden Gesundheitssystem leiden.
Eine gefährliche Selbsttäuschung
Merz argumentiert, der Ukraine-Krieg sei ein Kampf um „unsere Ordnung“, um „unsere Werte“, um „die Zukunft Europas“. Das klingt gut. Ist aber nur die halbe Wahrheit.
In Wahrheit geht es auch um Macht. Um das Ergreifen einer Gelegenheit. Um die Verschiebung der Kräfteverhältnisse – innerhalb Deutschlands, innerhalb der EU, im Verhältnis zu den USA.
Und es geht um Ablenkung: von der innenpolitischen Schwäche, von der wirtschaftlichen Krise, von der tiefen Spaltung der Gesellschaft. Diese Strategie aber hat Folgen: Sie verschiebt Aufmerksamkeit, Ressourcen und politische Energie weg von den wahren sozialen Problemen – und lässt ein Land zurück, das innerlich weiter zerfällt, während außenpolitisch Stärke simuliert wird.
Merz und der Preis der Führung
Friedrich Merz will als Staatsmann gelten. Doch er verwechselt Führungsverantwortung mit Führungsanspruch. Er glaubt, dass Lautstärke Stabilität schafft. Doch in Wahrheit verstärkt er nur das Rauschen.
Und während er Europa in Stellung bringt – mit dem Krieg als Karriereleiter – verliert er aus dem Blick, was seine eigentliche Aufgabe wäre: Das Land zusammenzuhalten. Die Gesellschaft zu beruhigen. Einen Weg aus der Dauerkrise zu weisen, der mehr ist als eine neue Waffenlieferung.
Was bleibt, ist ein Kanzler, der gefallen will – den Märkten, den Militärstrategen, der transatlantischen Elite. Doch der eigene Rückhalt bröckelt.
Fazit: Ein Kanzler für den Krieg – aber nicht für den Frieden
Friedrich Merz hat sich entschieden: für eine Politik der Härte, der Führung, der Konfrontation. Er inszeniert sich als Bollwerk gegen Tyrannei – und blendet dabei aus, wie viel Autoritäres bereits in seinem eigenen Regierungshandeln steckt.
Er regiert, als wäre Krieg Normalzustand. Und tut so, als ließe sich Stabilität nur mit militärischer Macht herstellen. Das ist gefährlich. Und es ist falsch.
Ein Kanzler, der nur weiß, wie man im Krieg regiert, wird nie wissen, wie man den Frieden gewinnt.
⸻
Ende Teil 2 – Vorschau auf Teil 3:
„Rendite statt Rente – wie Friedrich Merz den Sozialstaat zur Verfügungsmasse des Marktes macht.“