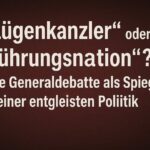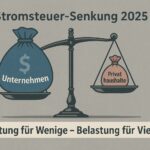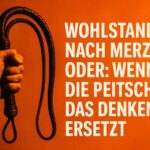Von der Transformation zur Militarisierung – so lässt sich die Entwicklung beschreiben, die Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne als „Chance“ bezeichnet. Der Bau einer neuen Munitionsfabrik durch Rheinmetall in Unterlüß sei ein positives Signal für den Standort, lobt der Minister. 500 neue Arbeitsplätze. 400 Millionen Euro Investition. Beeindruckende Zahlen – doch was sagen sie tatsächlich aus?
In einer Zeit, die dringend nach zukunftsfähigen Lösungen ruft, wird mit altbekannten Reflexen geantwortet: Aufrüstung statt sozial-ökologischem Strukturwandel. Waffenproduktion statt Investitionen in Bildung, Gesundheit oder nachhaltige Energie. Ist es wirklich ein Fortschritt, wenn staatliche Politik zunehmend auf militärische Wertschöpfung setzt?
Tonne sagt: „Keiner von uns hält Krieg für gut.“ Doch was bedeutet das, wenn gleichzeitig Hunderttausende Artilleriegranaten pro Jahr produziert werden sollen? Wenn Motoren für Raketen und Kampfpanzer zur wirtschaftlichen Hoffnung erklärt werden? Die politische Sprache hat sich entkoppelt von der Realität der Produkte, die hier entstehen.
Selbstverständlich ist der militärische Konflikt in der Ukraine erschütternd. Doch gerade angesichts eines Krieges, der – so ehrlich muss man sein – nicht nur durch russische Aggression, sondern auch durch Jahrzehnte geopolitischer Spannungen und Interessenpolitik auf beiden Seiten angeheizt wurde, ist Besonnenheit gefragt. Wer in dieser komplexen Lage einzig auf Aufrüstung setzt, sendet ein bedenkliches Signal: als wäre Krieg die neue Konstante, und Frieden ein naiver Traum .
Arbeitsplätze allein rechtfertigen nicht jede Industrie. Die Frage bleibt: Wollen wir als Gesellschaft tatsächlich, dass unsere wirtschaftliche Zukunft auf Zerstörung und Verteidigung basiert – statt auf Innovation, Bildung und Miteinander?
Der Minister lobt Tempo und Effizienz beim Fabrikbau. Doch was wird hier gebaut? Es sind nicht Windräder oder Schulen – es sind Sprengköpfe. Dass der Spatenstich von Bundeskanzler und Verteidigungsminister begleitet wurde, zeigt, wie weit die politische Normalisierung der Rüstungsindustrie bereits vorangeschritten ist. Kritische Stimmen fehlen – fast schon auffällig.
Dabei geht es nicht um Verharmlosung von Gewalt. Es geht um Perspektive. Um Mut zu einer Industriepolitik, die dem Frieden dient – nicht nur der Abschreckung. Und um eine Gesellschaft, die ihre Arbeitsplätze nicht daran misst, wie viele Granaten sie produzieren kann, sondern daran, wie viele Zukunftschancen sie schafft.