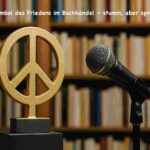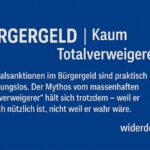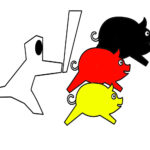Es gibt Geschichten, die klingen zu vertraut, um noch hinterfragt zu werden. Eine davon beginnt so: Deutschland fehlt es an Fachkräften. Von der Pflege bis zur Programmierung, von der Kita bis zur Krankenhausstation. Politiker wiederholen es, Wirtschaftslobbys beklagen es, Medien tragen es weiter – ein Mantra, das so oft gehört wird, dass kaum noch jemand fragt, wem es eigentlich nützt.
Doch schaut man genauer hin, bröckelt das Bild. Der angebliche Fachkräftemangel ist weniger ein Mangel an Menschen als ein Mangel an fairen Bedingungen. Denn was hier als ökonomische Notwendigkeit verkauft wird, ist oft ein Programm zur Lohnsenkung. Migration, die als Rettung gefeiert wird, dient dabei nicht selten der Aufrechterhaltung eines Systems, das billige Arbeit braucht, aber keine sozialen Sicherheiten bieten will.
Vom Wirtschaftsstandort zum Arbeitskräftelager
Schon in den 1950er Jahren importierte die Bundesrepublik „Gastarbeiter“ – Menschen, die kamen, um zu schuften und wieder zu gehen. Sie bauten das Wirtschaftswunder mit auf, blieben aber in den Narrativen der Nation Fremde. Heute hat sich die Sprache verändert: Aus dem Gastarbeiter wurde die „Fachkraft“. Die Logik blieb gleich. Deutschland greift auf die Bevölkerung der Welt gemäß seinem ökonomischen Bedarf zu.
Migration wird in der politischen Debatte als moralisches Projekt verkauft: offene Grenzen für die, die mit anpacken. In Wahrheit ist sie hochreguliert, selektiv und von kapitalistischen Interessen getrieben. Arbeitsminister reisen in den globalen Süden, um Pflegekräfte, Handwerker und IT-Spezialisten anzuwerben – nicht aus Mitgefühl, sondern um Löhne zu drücken und demografische Statistik zu verschönern.
Wenn der deutsche Staat von „fairer Einwanderung“ spricht, meint er meist: „fair für die Unternehmen“. Für die Menschen, die kommen, beginnt oft ein Leben zwischen Anerkennungschaos, kultureller Distanz und prekarer Bezahlung. Die historische Kontinuität ist frappierend: von der italienischen Anwerbung der 1960er bis zur philippinischen Pflegekraft von heute.
Arbeitsmangel statt Fachkräftemangel
Der „Mangel“ zeigt sich in Wahrheit an anderer Stelle: an sicheren Jobs, an Tarifverträgen, an sozialer Wertschätzung. In der Pflege etwa wandern Fachkräfte nicht ab, weil sie unfähig sind, sondern weil sie ausgebrannt werden. In der Industrie fehlen keine Ingenieure, sondern Unternehmen, die bereit sind, in Ausbildung zu investieren, statt Outsourcing als Dauerstrategie zu betreiben.
Die Klage über den Fachkräftemangel funktioniert dabei wie eine rhetorische Nebelmaschine: Sie verschiebt die Verantwortung von den Betrieben auf die Gesellschaft. Wenn die Unternehmen keine Fachkräfte finden, so heißt es, dann liegt das an der Faulheit der Jugend, an zu viel Freizeit, an zu wenig Bildung. Aber nicht an der Weigerung, anständige Löhne zu zahlen.
Hinzu kommt: Die gegenwärtig schwächelnde Wirtschaft übt zusätzlichen Druck auf Beschäftigte aus. Unternehmen sparen an Personal, verlangen mehr Leistung für weniger Geld und nutzen die Angst vor Entlassungen, um Lohnforderungen kleinzuhalten. Der angebliche Fachkräftemangel wird so zum Druckmittel, um Arbeitsrechte auszuhöhlen und Konkurrenz unter den Arbeitenden zu verschärfen.
Migration als moderne Ausbeutung
Der Fachkräftemangel ist die Legende, mit der Ausbeutung legitimiert wird. Was in den USA mit indischen IT-Arbeitern begann – billig, austauschbar, abhängig – wiederholt sich in Deutschland auf eigene Weise. Nur heißt das Visum hier „Blue Card“ statt „H-1B“. Auch hier sichern Visa und Aufenthaltsstatus die Macht des Arbeitgebers. Wer den Job verliert, verliert oft das Bleiberecht.
Die Illusion, dass Einwanderungspolitik ein Win-win sei, zerfällt beim Blick auf die Realität. Deutschland profitiert, die Herkunftsländer verlieren – Ärzte, Lehrer, Pflegekräfte, die dort fehlen. So wird aus globaler Mobilität eine neue Form des Kolonialismus: Wohlstand im Norden, Fachkräftelücke im Süden.
Zeit für ein neues Narrativ
Wer den Fachkräftemangel ehrlich diskutieren will, muss über Macht sprechen. Über Arbeitsrechte, Bildung, Löhne und über die Frage, wie viel ein Menschenleben wert ist, wenn es nicht auf dem deutschen Arbeitsmarkt gebraucht wird.
Vielleicht ist der Fachkräftemangel also kein Märchen, sondern eine Moritat – eine lehrreiche, dunkle Geschichte über Interessen, die sich als Notwendigkeit tarnen. Die Pointe? Es mangelt nicht an Fachkräften. Es mangelt an Ehrlichkeit.