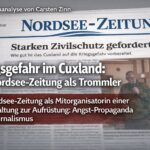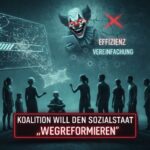Es beginnt mit einer Ohrfeige. Nicht mit Applaus. Nicht mit Triumph. Friedrich Merz, frisch nominierter Kanzlerkandidat, betritt den Bundestag – und fällt. Im ersten Wahlgang keine Mehrheit. Eine Premiere in der Geschichte der Bundesrepublik. Seit 1949 ist das nicht mehr passiert. Und doch ist es nur logisch.
Denn Merz wurde nicht gewählt, weil ihn jemand wollte. Sondern weil am Ende nichts anderes mehr übrig war.
Ein Mann kehrt zurück – aus der Kälte und der Konzernwelt
Friedrich Merz war lange weg. Politisch abserviert von Angela Merkel. Ein Mann der alten Schule, der zu eckig, zu offen, zu wirtschaftsnah war – zu unbequem für das Bild einer modernisierten CDU. Also zog er sich zurück. Erst innerlich, dann ganz. Und landete dort, wo marktradikale Politiker gerne enden: im Herzen des Kapitals. Bei BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt.
Viele sahen darin nur einen Karriereschritt. In Wahrheit war es die entscheidende Prägung. Denn Merz kehrte nicht als geläuterter Christdemokrat zurück, sondern als Manager mit Machtinstinkt. Er brachte nicht politische Erfahrung mit – sondern die Sichtweise eines globalen Investors.
Kein Volkskanzler – ein Produkt der Krise
Dreimal trat er an. Erst verlor er, dann verlor er noch deutlicher. Doch irgendwann waren alle Alternativen verbrannt, und die Union klammerte sich an das, was Stabilität versprach – oder zumindest danach aussah. Der Duktus eines Entscheiders. Die Rhetorik eines Ökonomen. Die Pose des Macher-Kanzlers.
Dabei war der Boden längst brüchig. Die Wahl gewann die CDU nur knapp – mit dem zweitschlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte. Die Koalition mit den angeschlagenen Sozialdemokraten war von Anfang an eine Zweckgemeinschaft. Die AfD jagte die Union in den Umfragen, während in den Reihen der eigenen Partei gemurrt wurde. Und Merz selbst: unbeliebter als jeder Kanzler vor ihm beim Amtsantritt.
Ein Kanzler ohne Vertrauensvorschuss. Ohne Aufbruchstimmung. Ohne Rückenwind.
Zwischen BlackRock und Grundgesetz
Was Friedrich Merz wirklich denkt, steht nicht im Parteiprogramm der CDU – sondern zwischen den Zeilen der Jahresberichte von BlackRock. Seine politische Sprache ist ökonomisch durchdrungen: Renten müssen „zukunftsfest“ werden (also kapitalgedeckt). Der Sozialstaat muss „schlanker“ werden (also privatisiert). Der Staat muss „Anreize setzen“ (für Investoren).
Merz glaubt an die unsichtbare Hand des Marktes. Nur leider hält er sie für seine eigene.
In ihm regiert kein Volksvertreter – sondern ein Interessenverwalter. Einer, der zwischen den Ruinen deutscher Industriepolitik und den gläsernen Fassaden der Finanzmärkte steht und sich fragt: Wie verkaufe ich das den Leuten?
Die Antwort ist simpel: Mit Härte. Mit klarer Kante. Mit einer Kanzlerschaft, die sich nicht am Gemeinwohl orientiert, sondern an den Bedürfnissen der Kapitalmärkte.
Die große Verwechslung: Stabilität ist nicht Härte
Merz verwechselt Autorität mit Führung, Lautstärke mit Klarheit, Härte mit Stabilität. Er tritt auf, als sei er der Notarzt für eine Nation im Delirium. Doch sein Rezept ist ein Medikament mit gefährlichen Nebenwirkungen: Aufrüstung, Schulden für Rüstungsprojekte, Abbau von Sozialleistungen, Privatisierung der Altersvorsorge.
Er spricht von Erneuerung – aber was er liefert, ist Rückbau. Er verspricht Führung – aber was er bringt, ist Spaltung. Zwischen den Menschen und der Politik. Zwischen Stadt und Land. Zwischen Markt und Moral.
Und während die Gesellschaft nach Orientierung sucht, liefert Merz dieselben Antworten wie vor zwanzig Jahren – nur jetzt mit größerem Budget.
Der Kanzler im Schatten der Macht
Merz ist kein Kanzler, der führen will, weil er eine Vision hat. Er ist ein Kanzler, weil das System ihn hervorgebracht hat. Ein Produkt der Leerstelle. Der Verdrängung. Des Mangels an Alternativen. Und vielleicht ist das das Tragischste an seiner Kanzlerschaft: Dass sie nicht für etwas steht – sondern gegen etwas anderes. Gegen den Zerfall der CDU, gegen die Übermacht der Grünen, gegen die AfD.
Aber gegen etwas zu sein, macht noch keinen Kanzler. Und schon gar keinen Staatsmann.
Zwischen Wirklichkeit und Wunsch: Ein Fazit
Friedrich Merz steht – symbolisch und real – zwischen zwei Welten:
Links die geschlossene Gesellschaft, die Abgehängten, die politischen Waisen einer sich wandelnden Republik. Rechts die Welt der Märkte, der Investmentfonds, der Daten und Kurven. In der Mitte: ein Mann, der Kanzler ist – aber kein Politiker.
Seine Realität ist eine andere. Seine Agenda auch.
Er regiert nicht für uns – sondern im Namen von Interessen, die sich kein Bürger je auf den Wahlzettel geschrieben hat.
Und genau deshalb ist Merz nicht der Kanzler, den Deutschland jetzt braucht. Sondern der, den ein kaputtes System hervorgebracht hat.
⸻
Ende Teil 1 – Vorschau auf Teil 2:
„Der Krieg als Hebel – wie Merz den Ukrainekonflikt zur Bühne europäischer Führungsambitionen macht.“