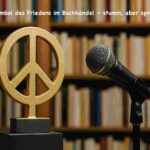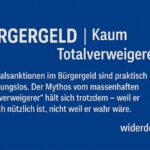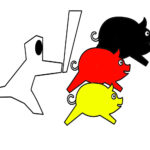„Russland ist der Feind“ – mit diesen Worten wurde Historiker Karl Schlögel für sein Lebenswerk geehrt – und das auch noch mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Ein Preis, der einst Bertha von Suttner und Lew Kopelew auszeichnete, feiert nun eine Kriegsrhetorik, die erschreckt. Zeit für Kritik.
Ein Friedenspreis für Kriegssprache?
Die Entscheidung, Karl Schlögel mit dem Friedenspreis auszuzeichnen, mag auf den ersten Blick nachvollziehbar wirken: Der Osteuropa-Historiker gilt als Experte für Russland und die Ukraine, hat sich früh kritisch gegenüber Putins Politik positioniert und engagiert sich öffentlich für die ukrainische Zivilgesellschaft. Doch wer genauer hinsieht, erkennt: Diese Preisvergabe ist kein Bekenntnis zu Frieden – sondern zur Eskalation.
Denn Schlögel sagt nicht etwa: „Putin ist unser Gegner“ – sondern: „Russland ist der Feind“. Das ist nicht nur eine rhetorische Entgleisung, sondern eine gefährliche Gleichsetzung: Ein ganzes Land, eine ganze Bevölkerung – zum Feind erklärt. Wo bleibt da die Differenzierung zwischen Regimekritik und Menschen?
Der „kritische Intellektuelle“ – mit NATO-Rhetorik?
In seiner Dankesrede sowie im begleitenden dpa-Interview plädiert Schlögel offen für militärische Aufrüstung, spricht davon, dass „Verteidigungsbereitschaft“ der einzige Weg zum Frieden sei. Das klingt nicht nach einem Friedenspreisträger – sondern nach einem politischen Hardliner.
Er übernimmt damit ein Narrativ, das wir aus strategischen Denkfabriken, militärpolitischen Reden und transatlantischen Thinktanks kennen. Es ist das Mantra: „Wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg.“ Doch genau dieses Denken hat Europa seit Jahrzehnten an den Rand eines militärischen Flächenbrandes gebracht.
Die Verwechslung von Aufklärung mit Frontbezug
Besonders irritierend: Medien wie die Frankfurter Rundschau oder die Deutsche Presse-Agentur inszenieren Schlögel als eine mahnende Stimme „für die Freiheit“. Der Artikel „Eine mahnende Stimme gegen Putin“ reduziert seine komplexe Biografie auf ein Feindbild – und stilisiert ihn zum westlichen Wahrheitspropheten.
Kritische Stimmen zu seiner Rhetorik? Fehlanzeige. Einwände zu seinem „Russland ist der Feind“-Zitat? Kein Thema. Stattdessen wird ein intellektueller Bellizismus gefeiert, der jede friedenspolitische Nuance vermissen lässt.
Dabei wäre ein echter Friedenspreisträger jemand, der Brücken schlägt, nicht Gräben vertieft. Der differenziert zwischen Regierung und Volk, zwischen Aggressor und Kultur, zwischen politischer Analyse und Feindmarkierung.
ZivilgesellschaftlichesEngagement–ja. Kriegsrhetorik–nein.
Niemand sollte wegsehen, wenn Völkerrecht verletzt wird. Aber wer mit dem Friedenspreis geehrt wird, trägt auch Verantwortung für die Worte, die er wählt.
„Russland ist der Feind“ – das ist eine Formulierung, die Mauern errichtet. Sie hilft nicht der russischen Opposition, nicht den kritischen Intellektuellen in Moskau, nicht den zivilgesellschaftlichen Brückenbauern. Im Gegenteil: Sie bestätigt autoritäre Kräfte in ihrem Propagandabild vom „feindseligen Westen“.
Fazit: Friedenspreise brauchen andere Vorbilder
Karl Schlögel ist ein herausragender Kenner osteuropäischer Geschichte. Doch mit seinem öffentlichen Auftreten in jüngster Zeit hat er sich von einer differenzierten Aufklärung entfernt – und dem geopolitischen Schwarz-Weiß-Denken zugewandt.
Dass ausgerechnet diese Haltung mit einem Friedenspreis geehrt wird, ist ein fatales Zeichen. Es sagt: Wer laut genug für Waffenlieferungen plädiert, darf sich Friedensstifter nennen.
Wir brauchen aber einen anderen Friedensbegriff: einen, der nicht auf Konfrontation, sondern auf Verständigung zielt. Einen, der Menschen verbindet – und nicht pauschal ganze Länder zum Feind erklärt.