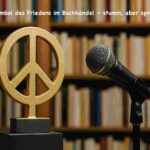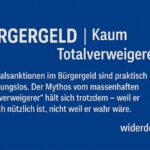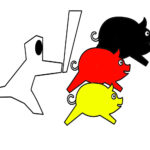In Deutschland wird seit Jahren immer weniger geprüft. Und nein, das ist kein bürokratischer Mythos, sondern amtlich belegte Realität. Zwischen 2015 und 2024 ist die Zahl der Betriebsprüfungen um fast 60 Prozent eingebrochen. Statt knapp 192.000 Prüfungen wie 2015 wurden 2024 nur noch rund 140.000 Unternehmen kontrolliert. Die Zahl der Betriebsprüfer selbst schrumpfte um etwa zehn Prozent – heute sind es kaum mehr als 12.350 Beschäftigte.
Warum so wenige Prüfungen?
Die Finanzämter suchen händeringend Personal, finden es aber nicht. Wer will auch in Zeiten von Homeoffice und Start-ups im muffigen Amtszimmer Aktenberge wälzen? Dazu kommt: Die Fälle sind komplizierter geworden. Internationale Firmengeflechte, ausgeklügelte Steuerkonstrukte und digitale Buchhaltungen fressen Zeit. Und als wäre das nicht genug, wurden die verbliebenen Prüfer auch noch für Sonderprojekte wie die Grundsteuerreform abgezogen.
Weniger Kontrolle, weniger Einnahmen
Was passiert, wenn kaum einer mehr nachschaut? Genau: Die Nachzahlungen sacken ab. Früher holte der Staat jährlich um die 16 Milliarden Euro nach. Inzwischen dümpeln wir bei elf Milliarden. Milliarden, die fehlen – in Schulen, in Kliniken, in der Infrastruktur. Gleichzeitig steigt die Versuchung, „kreativ“ zu werden: Wer weiß, dass ein Kleinbetrieb nur alle paar Jahrzehnte geprüft wird, der überlegt sich zweimal, wie genau die Buchhaltung aussehen muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass auffliegt, was man verschleiern möchte, sinkt dramatisch.
Das kreative Spiel mit dem Risiko
Vor allem kleine und mittlere Unternehmen geraten kaum noch ins Visier. Rein rechnerisch wird ein Kleinstbetrieb nur alle 150 Jahre kontrolliert. Solange kein Verdacht aufploppt, heißt das de facto: freie Fahrt. Juristen warnen, dass dadurch ein systematischer Anreiz entsteht, Gesetze auszutesten, weil die Gefahr, erwischt zu werden, so gering ist. Steuervermeidung und Steuerhinterziehung bleiben im Schatten – und der Rechtsstaat verliert an Glaubwürdigkeit.
Die andere Seite: Großunternehmen
Regelmäßig geprüft werden vor allem die großen Konzerne. Das klingt nach Fairness, ist es aber nicht. Denn gerade diese Unternehmen nutzen die Spielräume internationaler Steuerkonstruktionen: Briefkastenfirmen, verschobene Gewinne, Lizenzgebühren oder Patentboxen. Kompliziert, teuer, aber hochwirksam – und meist legal genug, um den Anschein von Ordnung zu wahren. So entstehen Milliardenschäden nicht trotz, sondern gerade wegen der regelmäßigen Prüfungen: Die Prüfer laufen den Konstrukten hinterher, während das Geld längst ins Ausland verschoben wurde.
Weniger Prüfungen bedeuten nicht weniger Steuerhinterziehung – sie bedeuten mehr unentdeckte Steuerhinterziehung. Und dort, wo geprüft wird, offenbart sich die nächste Schwäche: ein System, das legale Tricks zulässt und dadurch Milliarden verliert. Währenddessen wird die „Jagd“ auf Bürgergeld-Empfänger und vermeintlich Faule verstärkt – ein paar tausend Fälle, die im Verhältnis verschwindend klein sind, aber in der öffentlichen Wahrnehmung aufgeblasen werden. Woche für Woche wird ein neues „Opfer“ durch die Presse gezerrt, während bei Unternehmen Milliardenbeträge durchrutschen.
Der Staat spart am falschen Ende, verliert jedes Jahr Summen, die für Gemeinwohl dringend gebraucht würden, und erzieht gleichzeitig dazu, Steuergesetze eher als Vorschlag denn als Verpflichtung zu sehen.
Das ist kein Zahlenspiel für Fachzeitschriften. Das ist ein politischer Skandal.